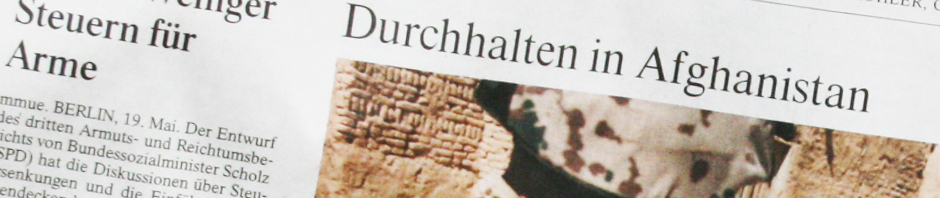Die politischen Entscheidungen sind zunächst einmal abhängig von virologischen und epidemiologischen Annahmen, aber auch von den Ansichten über die richtige Behandlung Kranker und über medizinische Ethik, vom Zustand und den Kapazitäten der Altenpflege und der Krankenhäuser.
Hier gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und wenig gesichertes Wissen, auch weil das Virus neu ist – und weil die politischen Verhältnisse im Fluss sind. Die Virologen, die Epidemiologen, die medizinischen Praktiker produzieren mittlerweile deutliche wechselseitige Kritiken; im Spiel sind aber auch die großen Unterschiede der verschiedenen Länder hinsichtlich der allgemeinen Verhältnisse wie Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, wie Gewohnheiten des Zusammenlebens etc. Der eigene Informationsstand der Bevölkerungen und ihre Disziplin sind außerdem von bedeutendem Einfluss auf die Möglichkeit von Vorhersagen, Planung und politischen Maßnahmen.
Ich führe im Folgenden nur einige der markantesten Beispiele von öffentlichem Dissens an, wie er in den letzten Wochen offenbar geworden ist.
Zunächst einmal weiß bisher noch immer niemand Genaues über die Zahlenverhältnisse, bspw. zum Verhältnis von gefährlich Infizierten und Gestorbenen zur Gesamtzahl der in der Bevölkerung insgesamt Infizierten, zu den Zahlen der immunen oder nur schwach betroffenen Menschen. Das gilt für die einzelnen Länder wie auch weltweit. Die meisten statistischen Aussagen scheinen bisher ungesichert bis willkürlich zu sein. Die absoluten Zahlen der Gefährdung durch CoViD19 sind ungewiss ebenso wie ihre Relativität zu den Gefährdungen durch andere Pandemien und überhaupt zu Gesundheitsrisiken aller Art.
Die Meinungen scheinen auch deutlich auseinanderzugehen, wenn man definieren will, welchen Anteil das aktuelle Virus an den registrierten Fällen von schwerer Erkrankung und Tod in Wirklichkeit hat – ist es, wie manche drastisch formulieren, in vielen Fällen alter und bereits schwer erkrankter Patienten nur der Auslöser eines ohnehin bald zu erwartenden Ablebens? Ist es in manchen Leichen zwar nachzuweisen, war aber nicht die Todesursache? Wird man den vielen sehr alten und meist bereits kranken Menschen, die die übergroße Mehrheit all der schweren Fälle bilden, von denen die befürchteten Überlastungen der Systeme ausgehen, menschlich und medizinisch auch nur annähernd gerecht, wenn man sie der Intensivbehandlung z.B. mittels Beatmung unterzieht? Die meisten überstehen diese Behandlung als solche kaum. Viele, wenn man sie denn überhaupt informierte und entscheiden ließe, würden sie wohl wegen der Quälerei und der schlechten Chancen von vornherein ablehnen. In diese Richtung jedenfalls haben sich Lungenfachärzte, Palliativmediziner und Medizinethiker bereits deutlich geäußert.
Ich habe bis hierhin einige streitbare Meinungen wiedergegeben, die ich in Form von Äußerungen von Experten (oder auch von angeblichen Experten) in den letzten Wochen in allgemein zugänglichen Medien zur Kenntnis nehmen konnte. Ich als Nichtexperte identifiziere mich nicht mit irgendeiner dieser einzelnen Meinungen, meine aber, dass in der aktuellen Situation allgemeiner Ungewissheit es wohl besser ist davon auszugehen, dass hier erst nach und nach wichtige Elemente der Wahrheitsfindung zur Sprache kommen.
Weiter:
Ist hier vielleicht auch ein zu großer Einfluss eines bestimmten einseitigen medizinischen Denkens im Spiel? Überwiegt das Denken in Kategorien der Apparatemedizin, gibt es eine Tendenz zur Entmündigung von Patienten, ein zu starkes Interesse an äußerst kostspieligen und damit für manche Akteure höchst profitträchtigen Verfahren? Bestimmen solche Interessen die medialen Bilder des medizinischen Geschehens?
Die Politiker können wohl nicht anders als „ worst cases“ im Auge zu haben und entsprechende Vorsorge zu treffen. Da aber die „worst cases“ in Abhängigkeit von solchen Variablen steht, wie ich sie eben kurz angesprochen habe, sind sie derzeit nur sehr unzureichend zu definieren. Der öffentliche fachliche und politische Streit belebt sich augenscheinlich, und das ist in mancher Hinsicht nicht schlecht.
Die Politiker müssen die ökonomischen und politischen Folgen von Quarantänen, Betriebsschließungen, Schul- und Universitätslähmungen etc. versuchen einzuschätzen, die ihrerseits voller Unsicherheiten stecken. Der hierzulande häufige Typ von Politiker stellt sich wohl auch Fragen wie: könnten in der Bevölkerung Stimmungen und Bewegungen entstehen oder verstärkt werden, die den führenden Parteien und Persönlichkeiten feindlich gegenüberstehen und bspw. das Parteiensystem gefährden, oder sich in Unruhen ausdrücken…
Jedenfalls aber muss die Politik gerade auch die großen Fragen, bspw. den europäischen Zusammenhalts, bspw. die Beziehungen zu China in politischer und ökonomischer Hinsicht im Auge haben und sich daran bewähren.
Die angesprochenen Unsicherheiten bieten reichlich Gelegenheiten, bestimmte globale politische Agenden in die aktuelle Situation hineinzumischen, die längst in der allgemeinen politischen Auseinandersetzung wichtig sind und keineswegs erst von den Fragen einer aktuellen Seuchenabwehr herrühren. Jeder Politiker, der/die jetzt öffentlich Meinungen äußert und an Entscheidungen beteiligt ist, wird auch daran gemessen werden, ob er/sie demgegenüber ein angemessenes Problembewusstsein an den Tag legen kann.
Ganz oben steht hier mE die Frage, ob und wie stark man die digitale Überwachung und die Steuerung der Bevölkerung vorantreiben darf, kann und will.
Jetzt wird unter dem label „Schutz aller vor der Seuche“ vieles angedacht und teilweise schon praktiziert, vielleicht sogar gesetzlich erlaubt werden, was die sozialen Kontakte der Bürger und ihre Mobilität betrifft. Manche fordern schon, in einer elektronisch geführten Personalakte den Gesundheitszustand, einschließlich der Willigkeit des Bürgers zur Zusammenarbeit mit dem problembeladenen medizinischen System, seine Tests, seine Impfungen etc. IT-mäßig zu erfassen und staatlich zu verarbeiten. Daraus wollen sie das Recht für akute, aber auch für künftige Eingriffe in das Leben der Bürger ableiten, bspw. wohin sie sich bewegen, mit wem sie Kontakt haben dürfen. Große gesellschaftliche Katastrophen können zwar schwere staatliche Eingriffe in Menschenrechte notwendig machen, aber hier arbeitet man an Kontroll- und Steuerungsverfahren für das Alltagsleben, an deutlichen Beschneidungen individueller Grundrechte, die auf Dauer etabliert werden könnten. Sollen wir demnächst in Verhältnissen ankommen, wie sie in China bereits in erheblichem Umfang existieren, oder in Verhältnissen, wie sie die Silicon-Valley-Giganten in ähnlicher Weise anstreben – Erfassbarkeit und Steuerbarkeit von Leistung, Konsum und politischem Verhalten der Bevölkerung zum höheren Wohle der Milliardärsschichten?
Überlegungen zu den Problemen der IT-Gesellschaft im Zeichen von Corona spielen in den mainstream-Medien anscheinend keine große Rolle, werden aber wohl von Manchen klar gesehen als eine bedeutende Weichenstellung auch für die Zukunft der EU und ihre internationalen Stellung. Es gibt eine Denkrichtung, die anstrebt, die EU künftig zur attraktivsten Zone im internationalen Wettbewerb um den Zufluss von Menschen und auch von Elementen des Kapitalismus zu machen – in diesem Sinne wäre es ein wesentlicher Baustein, dem IT-Autoritarismus a la China oder auch a la USA Regelungen entgegen zu setzen. Wie kann man z. B. die administrativen Vorteile der Datentechnik mit der Bewahrung der individuellen Freiheit und dem Schutz von Elementen der Demokratie verbinden?
Kapitalistische Krise und Corona
Die ökonomischen Systeme der Welt hatten sich, unabhängig und längst vor der Coronakrise, erneut als krisenanfällig, fragil, reif für drastische Erschütterungen, Zerstörungen und allgemeine Wohlstandsabstürze erwiesen. Es geht um die inneren ökonomischen Systeme einzelner Länder wie Deutschland, auch um die Europas; es geht um die gerade für Deutschland ökonomisch existentiellen globalen Beziehungen, namentlich den Verbund mit China, es geht um die enormen inneren Schwächen der USA und Chinas selber, schließlich auch um überwölbende System wie das internationale Finanzkapital.
Ein Beispiel ist die deutsche Autoindustrie, die zusammen mit ihren Zulieferern, Händlern etc. im Lande den wichtigsten Wirtschaftszweig und die Existenzbasis eines erheblichen Teils der Bevölkerung bildet. Zudem ist sie, wie das Beispiel des VW-Konzerns zeigt, der den größeren Teil seiner Profitabilität seinem China-Geschäft verdankt und, wie die anderen Firmen auch, aus aller Herren Länder, insbesondere auch aus den östlichen Ländern der EU, Zulieferungen bezieht, international extrem verflochten. Dieser Zweig der deutschen Ökonomie musste bereits deutlich vor dem Auftreten der Coronaprobleme zugeben, dass es nach unten gehen wird mit Beschäftigung, Löhnen und Gewinnen; man ist anscheinend technologisch ins Hintertreffen geraten hinsichtlich der Antriebe (wie Elektromotoren, Brennstoffzelle) und möglicherweise auch der Digitalisierung, und die Aussichten für das globale Geschäft, vor allem mit China und den USA, können angesichts der Verschärfungen v.a. zwischen den USA und China nur nach unten zeigen. Wenn jetzt im Zeichen von Corona staatliche Geldströme (Kurzarbeitergeld, Kredite zur Pleiteprophylaxe etc.) in beispielloser Fülle fließen sollen, dürften sie nicht nur zur Überbrückung kurzfristiger coronabedingter Schwierigkeiten, sondern erheblich auch zur Überdeckung schwerer politischer Fehler der Eigner und Manager der deutschen Automobilindustrie sehr willkommen sein.
Eine ganze Reihe weiterer, schon lange virulenter Fragen des ökonomischen und sozialen Lebens werden in der Corona- und Postcorona-Epoche drängender und könnten vielleicht in der öffentlichen Auseinandersetzung sogar im positiven Sinne intensiver behandelt werden. Dazu gehören Fragen wie:
- wie geht dieser Gesellschaft mit den Alten und Pflegebedürftigen um, welche Zustände in Heimen und in der Pflege allgemein haben sich eingeschlichen und müssen gründlich verbessert werden?
- Wie steht es mit dem allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung und ihrer gesundheitlichen Aufklärung?
- Hat das Gesundheitssystem genügend Kapazitäten, ist das Personal ausreichend und ausreichend ausgebildet, sind die Magazine für Notfälle angemessen gefüllt?
- Wie weit ist die Zersetzung durch die kapitalistische Profitorientierung schon gekommen, bspw. angesichts der Mängel an Forschung zu Medikamenten der Seuchenbekämpfung, seitens von Big Pharma? Oder angesichts des Kaputtsparens, wie es sich bspw. in den Krankenhäusern zeigt, weniger wohl in Deutschland als in vielen anderen Ländern, besonders verheerend anscheinend z. B. in Italien? Oder angesichts des Versickerns staatlicher Mittel in korrupten und mafiotischen Strukturen, wie es, vor allem wieder am Beispiel des unglücklichen Italien, sich erneut zeigt und eine Gefahr für die ökonomischen und moralischen Qualitäten der EU überhaupt darstellt?
Auch auf höchster globaler Ebene liefert die Coronakrise reichlichen Zündstoff. Die unterschiedlichsten Konflikte werden verschärft, bspw. die Rivalität zwischen China und den USA; auch das Ausgreifen Chinas, bspw. unter dem Etikett „Neue Seidenstraße“ nach Europa wird deutlich aggressiver. Aus den USA ihrerseits meldet sich jemand wie Bill Gates mit seinen problematischen globalen Vorstellungen medizinischer, kapitalistischer und politischer Art und seinem milliardenschweren Einfluss auf die WHO. Ihnen und noch vielen weiteren Akteuren gibt die Krise reichlich Gelegenheit, verschärft um Erfolge zu kämpfen.
Das Augenmerk richtet sich auch unwillkürlich auf die weitgehende Ausgeliefertheit großer Teile der Weltbevölkerung, bspw. des Kontinents Afrika, an Gesundheitsgefahren. Dort existieren bekanntlich die elementarsten Dinge nicht oder kaum; wenn nun dort Millionen wehrlos von dieser und anderen zukünftigen Seuchen dahingerafft werden sollten, bekommt die Frage, warum das so ist, warum dort die Armut und das Unwissen und hierzulande so etwas wie Reichtum und soziale Systeme herrschen, noch mehr Aktualität.
Den hier genannten Fragen sieht man direkt an, dass ihnen auch positive Impulse entspringen können. Es ist nicht vorherbestimmt, dass die Interessen der Datenschnüffler und Bevölkerungs-Manipulateure wesentlich vorankommen; nicht, dass die großen kapitalistischen Profiteure (nicht nur im medizinischen Bereich) sich auf Kosten der Allgemeinheit weiter stärken; nicht, dass die rivalisierenden großen Mächte ihre Einflüsse verstärken können, wie sie das anscheinend durch „Corona“ jetzt gern erreichen würden.
Technischer Hinweis zur Kommentarfunktion auf diesem Blog:
Bitte richten Sie Kommentare, Hinweise, Kritiken und alles Relevante an meine e-mail-Adresse wagrobe@aol.com. Die direkte Kommentarfunktion auf diesem Blog mußte ich, vor längerer Zeit bereits, leider abschalten, weil sie zur Abladung von Massen von Webmüll mißbraucht wurde, der mit den Beiträgen absolut nichts zu tun hatte.
Ich verspreche jede sachlich irgendwie relevante Zuschrift dann im Anhang zu dem betr. Beitrag zu veröffentlichen, auch wenn sie mit meinen Ansichten garnicht übereinstimmen kann.